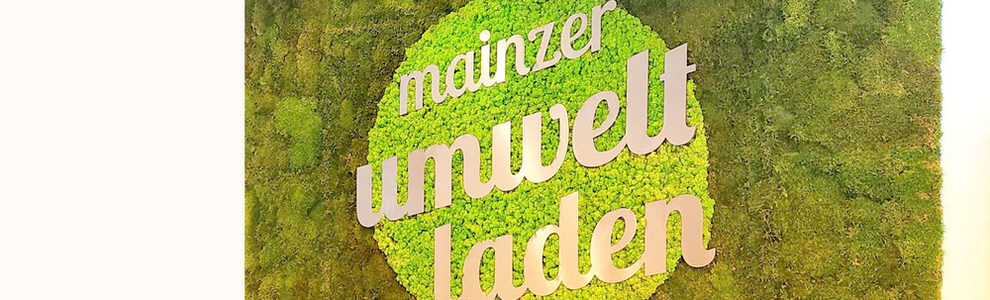Umwelttipp Stadtklima im Wandel: So passen wir uns an
Warum Städte sich an die Klimawandelfolgen anpassen müssen
Städte sind für ca. 80 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und für über 70 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, sie tragen stark zum Klimawandel bei und bekommen die Folgen der Klimaveränderungen unmittelbar zu spüren. Anhand von Temperaturaufzeichnungen wird das sichtbar. Seit dem Ende der 1980er Jahre ist in Rheinland-Pfalz ein deutlicher Anstieg der mittleren Jahrestemperatur nachweisbar. Das Jahr 2020 war das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881.
Zudem weisen Städte eine dichte Bebauung, starke Bodenversiegelung, fehlende Vegetation und erhöhte Emissionen im Vergleich zum Umland auf. Passen wir uns nicht an die klimatischen Veränderungen an, führen diese ungünstigen Bedingungen zu einer Verschlechterung der Lebensqualität in der Stadt, einhergehend mit Belastungen und Gefahren für Mensch und Umwelt.
Wo liegen die Gefahren?
Anhaltende Hitzephasen führen dazu, dass die Stadt sich tagsüber aufheizt und nachts nicht mehr ausreichend abkühlt. Gerade die dunklen Oberflächen von Gebäuden, Straßen, Gehwegen und Plätzen erwärmen sich wegen ihrer niedrigen Albedo (Reflexion von Wärme) stark und können die Wärme anhaltend speichern. In den Innenstädten wird dieser Effekt noch verstärkt durch Verkehr oder durch die Abwärme von Klimaanlagen. Es entsteht eine starke Belastung durch Wärme. In den Innenstädten können doppelt so viele heiße Tage auftreten, wie im Umland. Der Temperaturunterschied kann dabei bis zu 10°C betragen. Den Effekt der Städte auf die Temperatur nennt man „Wärmeinseleffekt“.
Besonders an heißen Tagen kann es zu Starkregen kommen, wenn die Luft relativ feucht ist. Schwierig vorhersagbar und lokal begrenzt fallen innerhalb von wenigen Minuten immense Regenmengen, oft auch von Hagel begleitet.
Der allgemeine Temperaturanstieg kann zu einer Verstärkung von Luftdruckgegensätzen und somit zu einer geänderten Sturmhäufigkeit führen. Von Stürmen wird im Allgemeinen bei Windstärken von 74 bis 117 km/h, ab 118 km/h wird von Orkan gesprochen.
Die Gefahren liegen auf der Hand: Hohe Temperaturen und Temperaturschwankungen stellen eine gesundheitliche Belastung dar und schränken die Lebensqualität ein. Die Lebensbedingungen für Tiere und Vegetation in der Stadt verschlechtern sich unter Hitze und Wassermangel. Gerade Stadtbäume mit geringer Widerstandsfähigkeit gegen diese Belastung können schnell in Stresssituationen kommen, ihre Leistungsfähigkeit verlieren und schlussendlich absterben. Stürme und Sturzfluten mit Überschwemmungen führen zu Schäden an öffentlicher Infrastruktur und Privateigentum. Es entstehen Folgeschäden mit hohen Kosten.
Herausforderungen und geeignete Maßnahmen
Um die Lebensqualität unserer Städte zu erhalten, müssen Anpassungsmaßnahmen lokal erfolgen. Sowohl öffentliche Gebäude, Straßen, Grünanlagen und Plätze, als auch unser Zuhause können jetzt schon angepasst werden. Stadt- und Umweltplanung stellen die notwendigen Weichen für eine klimaangepasste Zukunft. Die Vorsorge, die wir heute treffen, entscheidet über unsere Lebensqualität und die der zukünftigen Generationen. Um die Temperaturen in der Stadt erträglich zu halten, ist es wichtig, Kaltluftentstehungsgebiete außerhalb der Stadt und Kaltluftbahnen in die Stadt hinein zu kennen und diese (auch von Verbauung) freizuhalten. Zum Beispiel sind Ackerflächen sehr gute Kaltluftentstehungsgebiete.
Gebäude können durch die Auswahl der Baustoffe sowie durch die Wahl des Standortes und durch die Ausrichtung des Gebäudes gegen Extremwetterereignisse geschützt und damit an die ansteigende sommerliche Hitze angepasst werden.
In der Stadt sind Wasser, Bäume und anderen Pflanzen, die durch Verdunstungskälte ihre Umgebung kühlen, wichtige Elemente. Ein hoher Anteil an Wasser und Grünflächen wirkt als natürliche Klimaanlage. Sie hilft, die Temperaturen zu senken. Mit dem Konzept der „Schwammstadt“ kann Regenwasser vor Ort durch begrünte Dächer, entsiegelte Böden oder durch Pflanzen aufgenommen werden. Bei Starkregen mit großen Mengen an Regenwasser kann dadurch ein Anteil des Wassers zurückgehalten werden, der ansonsten oberirdisch abfließt und die Kanäle überlastet. Mit dem Konzept Schwammstadt soll Regenwasser dort zwischengespeichert werden, wo es fällt. Landschaftsplanerische Elemente dafür sind zum Beispiel versickerungsfähige Verkehrsflächen, Pflaster, Mulden, Rigolen, urbane Grünflächen und Feuchtgebiete.
Deutschlandweit wird bereits untersucht, welche Bäume zukünftig in Städten gepflanzt werden können und dem Klimawandel trotzen. Hierbei werden neben heimischen auch Baumarten aus anderen, angrenzenden Klimaregionen auf ihre zukünftige Einsetzbarkeit getestet.
Mainz passt sich an
Durch die geografische Lage im Oberrheingraben und ihre historisch gewachsene dichte Stadtstruktur mit wenigen Grünflächen gehört die Landeshauptstadt Mainz zu den thermisch höchstbelasteten Städten Deutschlands. Um sich an die Auswirkungen der Klimaveränderungen anzupassen entwickelt Mainz Maßnahmen auf zwei Ebenen:
- Maßnahmen, die der Erderwärmung entgegenwirken. Hierbei ist Ziel, die Klimaneutralität bis 2035 durch Halbierung des Endenergieverbrauchs gegenüber 1990 und durch die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um 95% zu erreichen.
- Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel über eine Strategie mit fünf Themenfeldern und 24 Schlüsselmaßnahmen, die bereits in der Umsetzung sind.
Nähere Infos, siehe Linkliste unten.
Tipps zur Klimaanpassung
Auch im privaten Bereich gibt es Möglichkeiten, sich an das Klima angepasst zu verhalten und das Zuhause klimagerecht zu gestalten.
Sonnenschutz: Wärmeschutzverglasung, Rollläden und Jalousien anbringen.
Belüftung: Nachts und am frühen Morgen lüften, wenn es kühler ist, tagsüber Fenster und Türen geschlossen halten. Stellen Sie Ventilatoren auf, um die Luftbewegung zu erhöhen, was als kühler empfunden wird.
Elektrische Geräte und Heizung: Geräte, die Wärme abstrahlen, nur bei Bedarf einschalten und Standby-Modus vermeiden. Auf gute Wärmedämmung achten, Heizung im Sommer auf Sommerbetrieb stellen und Geräte effizient nutzen.
Mikroklima verbessern: Gestalten Sie Balkon, Terrasse oder Garten mit schattenspendenden Pflanzen. Selbst ein kleiner Brunnen mit Pumpe verbessert das Mikroklima.
Starkregen- und Überflutungsschutz: Treffen Sie Eigenvorsorge, z.B. durch Rückstauklappen und bauliche Veränderungen, damit kein Wasser in Ihr Haus eindringen kann.
Woche der Klimaanpassung im Mainzer Umweltladen
Vom 01.09. - 30.09.2025 findet die „Woche der Klimaanpassung“ im Mainzer Umweltladen statt. Begleitend zu einer Ausstellung werden Vorträge und Führungen angeboten. Infos und Anmeldungen bei Lara Meurer, Grün- und Umweltamt, Tel. 06131-12 4147.
Weitere Informationen
Adresse
- Telefon
- +49 6131 12-2121
- Telefax
- +49 6131 12-2124
- umweltinformationstadt.mainzde
- Internet
- Veranstaltungen im Umweltladen
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten:
Montag: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Dienstag: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Mittwoch: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Donnerstag: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Freitag: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Jeder 1. Samstag im Monat: 10 Uhr bis 14 Uhr
Erreichbarkeit
Haltestellen / ÖPNV
Linien: 6, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 78,
80, 81, 90, 91, 653, 654, 660